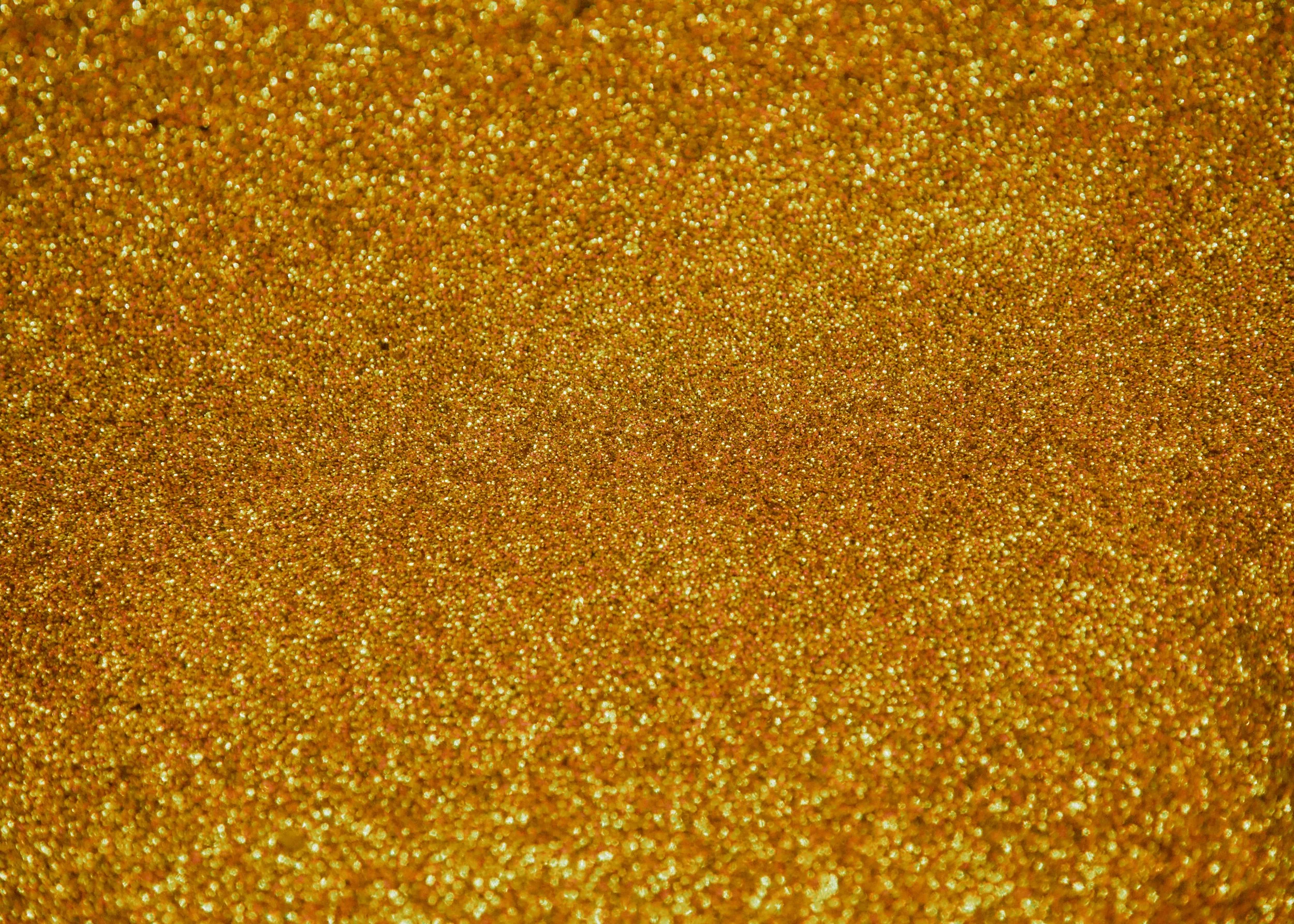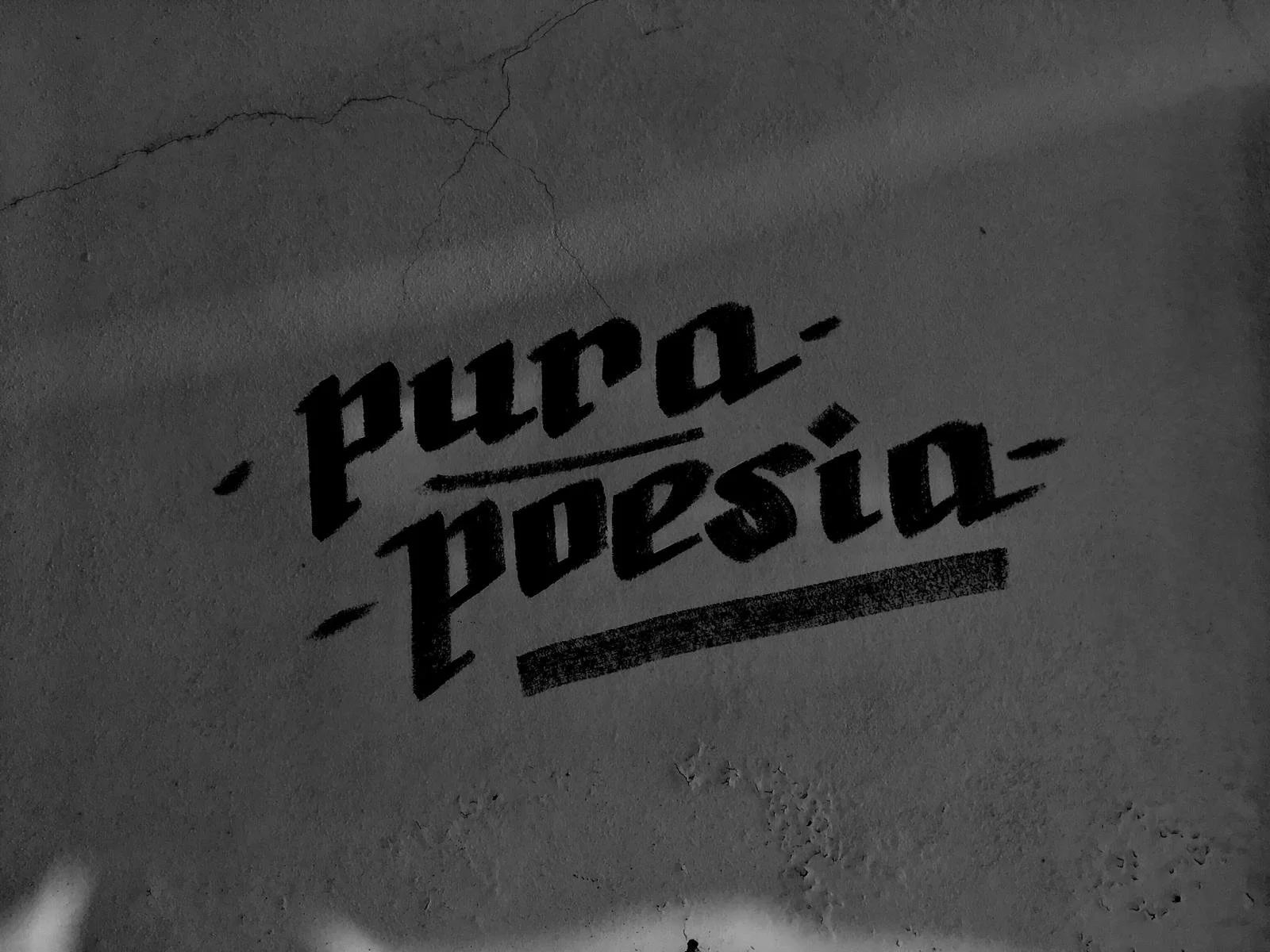Mit Einstecktuch zu Rewe
Nachtgedanken zu Kunst und Leben
Anmerkung der Redaktion:
Der folgende Beitrag wurde uns mehrfach und in unterschiedlicher Form, wahrscheinlich von einem jungen Mann zugespielt. Er trägt Einstecktuch und erkundet die Welt mit einem Gehstock. Falls Sie jetzt denken, es müsse sich um unseren Emil, den literarischen Streuner, handeln, muss ich Sie enttäuschen. Naja, der Beitrag wurde uns also als Brief, als ellenlange E-Mail, die Dr. D. sofort löschte, weil, wer so lange E-Mails schreibt, wird ignoriert. Der folgende Text wurde in Auszügen sogar an die Wand des Literaturhauses gesprayt. Nun haben wir uns entschieden, dieses wildwüchsige Opinion Piece zur Frage, was Literatur ist und was nicht - ja man könnte es schon beinahe als Manifest bezeichnen - doch zu veröffentlichen. Der Leser muss wissen, dass der vorliegende Text nicht notwendig die Meinung der Redaktion widerspiegelt. Genießen Sie also diesen Ritt mit Vorsicht! Um die Identität des Autors zu schützen, nennen wir ihn hier Uli S.
Die Redaktion
(Noch) kein Celebrity!
Ich melde mich ungern aus der Unterstadt. Das müsst Ihr mir glauben. Ich habe mich hier einigermaßen eingerichtet. Ja, ich bin fast nur noch zuhause. Menschen wie mich habe ich einst verachtet. Damals ging ich in Clubs, Restaurants, Bars. Ich liebte das Nachtleben. Kulturveranstaltungen hasste ich immer. Heute muss ich mir das Außen vom Hals halten: das Geschwätz, die Geschmacklosigkeiten in der Sprache, im Umgang, in der Mode, die himmelschreiende Dummheit. Heute werde ich mich einmischen. Denn am meisten setzt mir das große Missverständnis zu, das die Kunst angeht. Mehr denn je gilt sie gegenwärtig vielen als Trägerin spezifischer politischer oder ideologischer Botschaften: ein intellektueller Graus! Kunst braucht zuallererst Unschärfe. Dann Leidenschaft.
Bevor ich meine Einwände ausführe, muss ich etwas gestehen, und das fällt mir nicht leicht. Natürlich haben meine Ausführungen mit gekränkter Eitelkeit zu tun. Ich verlasse das Haus nur noch mit Sonnenbrille. Schwarz oder blau? Fast unmöglich zu entscheiden. Ich will nicht verbittert rüberkommen, und gleichzeitig will ich der Welt da draußen den Mittelfinger zeigen. Ich bin ein Gernegroß. Und als Gernegroß verwechsle ich mich oft mit den echten Großen. Ich denke, wie vielleicht andere auch, die niemand kennt, dass ich besonders interessant bin, und mit dem Alter wird die Frustration darüber größer, dass das noch immer nicht erkannt wurde. Langsam gewinnt der quälende Gedanke an Größe, dass man niemals von der Öffentlichkeit geschätzt werden würde. In Meta-Momenten wie diesem hier ist mir das natürlich peinlich. Aber ich bin auch ein wenig traurig darüber, dass diese gigantische innere Welt irgendwann einfach ungesehen mit mir untergehen wird. Trotzdem werde ich darauf verzichten, sie in Romanform im inneren Monolog literarisch auszuloten. Als billiger Ersatz funktionieren das Underground-Narrativ und Sätze wie: “Ist eh cooler, wenn man vom Mainstream nicht beachtet wird.”
Mit Paisley-Einstecktuch zu Rewe
Also, mit der Zeit wurde der Rückzug immer extremer. Der gedankliche und emotionale Weg in den Kunst-Extremismus war kurz. Ich trage jetzt wirklich Jogginghose, denn nicht mal ich kann den Schein noch aufrechterhalten. Es kostet zu viel Kraft, das passende Einstecktuch auszusuchen, um bei Rewe Milchschnitten zu kaufen. Obwohl es so nötig wäre! Ein Bund Gleichgesinnter, radikaler Verfechter der Schönheit, muss her. Sofort!
[...]
Sie ist nach willen nicht: ist nicht für jede
Gewohne stunde: ist kein schatz der gilde.
Sie wird den vielen nie und nie durch rede
Sie wird den seltnen selten im gebilde.
Stefan George hat ganz recht. Es ist beschwerlich, einen Abglanz des Vollkommenen erschaffen zu wollen. Und dann ist dieses Juwel für die meisten nicht mal sichtbar. Mit dieser elitären Einsicht müssen wir leben. Es hilft nichts, lauthals nach der Zugänglichkeit von Kunst zu krähen. Sie ist enigmatisch, wolkig, abgründig! Manchmal ist sie sogar einfach konsumierbar, in seltenen, äußerst gelungenen Fällen. Meist nicht. Die Vertracktheit der Sätze im Zauberberg lassen sich einfach nicht vom Genuss der Lektüre trennen. Gerade deswegen ist der Roman so geil! Verständlichkeit darf kein Qualitätskriterium sein! Nicht alles muss allen dienen. Und das ist ok. Sie, die Forderungen an die Kunst stellen, machen alles kaputt. Wem die Kunst heilig ist, der ist am Rand zuhause. Im Bewusstsein des Nichts, dessen kühlen Touch und unterschwellige Präsenz man spürt, wenn die Sinne ästhetisch wach sind, wird mir die Kunst zum Wesentlichen. Denn durch ihre Wesensverwandtschaft mit dem Ende alles Seienden hebt sie das Leben aus seinen Niederungen empor. Im besten Fall ist sie die Begegnung mit dem Tod selbst. Mindestens erinnert die Kunst an ihn. Auf die schönste Weise. Zwar ist der Tod jedermanns Sache. Aber es gibt nur wenig Kunst, die von ihm beseelt ist, ihn so sichtbar macht, dass er unser aller Leben verändert. Gute Kunst ist rar. Im Verblühen drückt die Aster ihre Schönheit aus. Von Anfang an trägt sie ein langsames Sterben in sich, das uns das Trugbild von Vollkommenheit zurückersehnen lässt. Dieses langsame Sterben ist ihre Schönheit. Wir müssen die Idee der Reinheit vom Fleck her denken, sagt der berühmte slowenische Philosoph, und nicht umgekehrt. Also nicht das Absolute, das Paradies als den Ort des Ursprungs denken, sondern die Müllhalde, von der aus das Paradies erst imaginiert wird. Ok. Samuel Beckett sagt dagegen, jedes Wort sei unnötige Beschmutzung des Schweigens. Und wenn wir dieses perfekte Schweigen mit unseren unzulänglichen Worten besudeln, dann bitte äußerst überlegt. Obwohl Slavoj Žižek behauptet, Beckett müsse das Verhältnis zwischen paradiesischer Reinheit und dem befleckten Irdischen umkehren, klingt für mich, was der irische Schriftsteller sagt, erstmal nach einem guten Leitfaden für alle, die schreiben wollen. Vor allem, wenn man sich die viel zu vielen mittelmäßigen bis schlechten Romane ansieht, die jedes Jahr erscheinen. Bitte immer annehmen, dass der Leser nicht so dumm ist wie man selbst! Dass wir das Nichts, das unbefleckte Weiß, in der Kunst vom Unvollkommenen her denken sollten, bedeutet nicht, dass wir bei der Produktion von Flecken das Göttliche nicht einmal mehr vor Augen haben sollten. Kunst darf bitte nicht zu irdisch werden! Wir müssen uns mit ihr übermenschliche Mühe geben! Schönheit ist der Weg in die Transzendenz. Heute das Einstecktuch mit Paisleymuster von Etro und die Persol-Sonnenbrille! Alles zurechtzupfen, trotzdem darf es nicht zu perfekt, zu bemüht aussehen. Lieber etwas shabby. Aber ist das nicht auch wieder zu bemüht? Aus solchen Schleifen kommt man nicht raus. Egal, ich muss mich zwingen. Auch wenn ich nur zu Hause am Schreibtisch sitze. Nein, gerade da! Durch all diese schönen Dinge werden wir ein bisschen unsterblich. Ein bisschen unverwundbar. Noch einmal das Ersehnte. Die Kunst ist heilig. Und ich lasse sie mir nicht in den Dreck ziehen. Immer wieder lese ich, die Kunst müsse heute politisch sein, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Mit Verlaub, einen Scheiss muss sie! Das Gegenteil ist der Fall. Niemals darf die Kunst zum Vehikel ideologischer, meist unterkomplexer, Botschaften verkommen. Sonst ist sie verloren.
Das Konkrete
Einige dieser politisch-ideologischen Botschaften finde ich gut. Oft sind sie halbgarer Dreck oder so allgemein gehalten, dass sich jeder irgendwie darauf einigen kann. Denkfaulheit! Man übernimmt Begriffe, die irgendwelche Agenturen - die “Philosophen” der Gegenwart - in ihrer eklatanten Stumpfsinnigkeit zusammenschustern. Natürlich hinterfragt man gar nichts, denn man ist auf der richtigen Seite. Welchen Gehalt hat eine hohle Phrase wie “Frieden für die Welt‘? Despoten und Kriegstreiber können sich ohne Weiteres unter diesem Allgemeinplatz versammeln. Was hilft eine solche Botschaft, meist vom warmen Wohnzimmer aus in die weite Welt hinaus geplärrt? Niemand kann so naiv sein und ernsthaft glauben, dass sich einer der Beteiligten nach Zurkenntnisnahme deutscher Friedensaufrufe sagt: “Mensch, ja! Lass uns aufhören. So haben wir das noch gar nicht gesehen. Danke, Deutschland!” Meist dienen Ermahnungen für die Welt einfach nur der moralischen Selbstvergewisserung und -beweihräucherung. Für ein Publikum, das eh mit allem, was in ihrer Bubble gesagt wird, einverstanden ist. Und das in dem Wissen, dass die in ihrer Kunst vorgebrachten Forderungen und Ideen entweder komplett illusorisch, naiv oder völlig am Wesen des Menschen vorbeigehen. “Dies ist als Aufruf zur Toleranz zu verstehen.” Ja, ok. Danke. Das ist entweder dumm oder zynisch. Beides ist verachtenswert. Wovon ich hier spreche, ist Pseudokunst. Aktivismus, Politik, Ideologie, Esoterik. All das hat eine Daseinsberechtigung. Aber nicht in der Kunst. “Schreiben gegen das Vergessen!”, lese ich heute und 100 mal in Verlagsvorschauen. Ja! Aber sicher nicht so, wie sich das die Kunstmoralisten vorstellen. Messaging in der Kunst? Meinetwegen als sekundärer Effekt. Aber bitte doch subtiler! Bildung und Kunst müssen gleichermaßen in den kommenden Generationen Emotionen hervorrufen sowie die Ausbildung einer Haltung zu Leben und Tod erwirken. Ohne Gefühl, Erschütterung, Trauer, Liebe und Sehnsucht funktionieren weder Kunst noch Bildung. Kunst, um uns erstrahlen zu lassen, oder wer es weniger kitschig möchte: um Intensitäten zu aktivieren. Wenn ich einen Wahnsinnsroman gelesen habe - und das passiert selten - umwölkt mich eine Atmosphäre, ein für dieses Welt spezifisches Gefühl. Es lässt mich die Einmaligkeit unserer Existenz fühlen. Metaphysik. Es vibriert noch Wochen oder Monate in mir nach. Jenseits von Inhalten! Vielleicht ändert es sogar meinen Blick auf die Menschen. Auf Leben und Tod. Auf alles! Möglicherweise gehöre ich nach der Lektüre zu einer Gemeinschaft Eingeweihter. Oder die Geschichte lässt mich unserer Realität und ihrem ganzen Abfuck für eine Weile entfliehen. Gute Geschichten haben vor allem anderen einen fundamentalen Effekt: Sie ordnen für uns - zwar in einer anderen Welt, in der sich das Ich derweil verliert - das Chaos der erlebten Gegenwart. Geschichten tun so, als wären sie möglich, als ob sich die Wirklichkeit von einer Geschichte disziplinieren ließe. Wir brauchen diese Illusion.
Bildung gegen das Vergessen. Glauben die Pädagogen der Kunst denn wirklich selbst, dass diejenigen, die vergessen wollen, Literatur mit dampfhammerigem Bildungsauftrag gegen das Vergessen lesen? Vielmehr lesen die moralinsauren Künstler ihre eigenen Bücher und rennen sich selbst offene Türen ein. Sie verändern nichts. Auf dass sie in ihrer Bubble bleiben und sich gut fühlen! Hauptsache man signalisiert der Welt (Deutschland) und sich selbst die richtige politische Haltung. In der Kunst. In den seltensten Fällen kann gute Kunst konkrete politische Inhalte (er)tragen, ohne unter der Last zusammenzusacken, was nicht bedeutet, dass sie unpolitisch ist. Im Gegenteil. Schönheit gegen das Vergessen und die Verrohung! Kunst ist heute politisch, postkolonial, progressiv, integrativ, manchmal sogar nationalistisch. Ja, all das ist wahr. Aber ist es Kunst? Selten. Meistens ist es etwas anderes.
Wir sind nur ganz kurz hier!
Wir sind nur ganz kurz hier. Allein der Sog dieser Erkenntnis sollte bereits Stil erzeugen! Stil und Form sind unsere moralische Pflicht gegenüber dem Leben. Das sind wir dem Schöpfer oder wem auch immer schuldig. Sogar dem Nichts. In der Kunst vermögen mir es, vermeintlich über unsere Natur hinauszuwachsen. Wir werden zu Göttern. Ist das nicht der eigentliche Maßstab für die Kunst? Kunst zeigt den Bruch im Denken zu sich selbst. Dabei entstehen die schönsten Formen. Das Ende des Denkens, das niemals in die Harmonie führt, sondern immer in die Paradoxie. Dieser Gedanke ist schwer zu ertragen, denn wir brauchen in allen Bereichen des Lebens smoothe Geschichten. In den Erzeugnissen der Kunst wird die niemals endende Frustration darüber manifest, den Sinn, den Kern der Dinge, wieder um Haaresbreite verfehlt zu haben. Wenn es gut lief, in einem geglückten Gedicht oder Bild, konnten wir das Unsagbare fast benennen. Wir sind zumindest schön gescheitert. Dies schöne Scheitern nimmt die Gestalt des literarischen, künstlerischen oder philosophischen Werks an. Ist aber Kunst nicht auch die kompromisslose, exzessive und farbenfrohe Feier dieses disharmonischen Lebens? Oder zumindest die Feier der Möglichkeit eines interessanten Lebens? Eine Revolution gegen das schrecklich Normale? Gegen die Wirklichkeit, wie sie in den Momenten ist, in denen wir uns nicht klar machen, dass wir sind.
Exkurs zum Kitsch und zur Peinlichkeit
Aber das Pathetische und das Kitschige! Letztlich egal. Dann machen wir uns eben lächerlich, weil erstens eh alles schon einmal gedacht wurde, und zweitens, weil wir uns und unsere Sache zu ernst nehmen. So what! Solange wir auf Erden wandeln, sind wir eben Rilkes Schwan, der an Land ungelenkt watschelt und erst dann zum edlen Geschöpf wird, wenn er ins Wasser (ins Jenseits) gleitet. Der Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre hat eine interessante Haltung zur Hybris des Normalos. Er findet es zum Beispiel anmaßend, wenn man irgend einen Schmarren, der einer alternden Madonna gerade einfällt, daneben findet, weil sie unser Urteil - die Geschmacksurteile von Hinz und Kunz - nicht interessiert. Denn sie sei ja Madonna, und wir Herr Meier. Wir können uns in der Tat darauf einigen, Herr Stuckrad-Barre, dass wir alle nur einfache Clowns sind. Das sagt der begnadete Beobachter alles menschlichen Kreuchens und Fleuchens nämlich oft in Interviews. Aber, dass alles schon gesagt und dass all das, was wir denken und wollen, klein und lächerlich ist, ist doch eh irgendwie klar. Dann dürfen wir uns aber auch total ernst nehmen und kitschig sein, Herr Barre, oder? Und warum sollten wir Normalos uns in grenzenloser Selbstüberschätzung nicht erdreisten, einen Popstar peinlich zu finden, wenn er/sie schlecht botoxt? Klar, dürfen wir! Durch das Urteil über die, die wir nie oder höchstens nur von weitem zu Gesicht bekommen, entsteht für einen Moment die Illusion von Macht. Das erhabene Gefühl, jemanden, der eh alles hat, peinlich zu finden und sich über ihn/sie zu erheben. Und wir fühlen uns gut. Das ist in Ordnung, und geht Madonna am Allerwertesten vorbei. Wir dürfen darüber nur nicht zu unangenehmen Personen werden. Letztlich müssen wir alles mit einem Augenzwinkern anfangen. Meinetwegen. Aber bitte lasst uns doch so tun, als sei alles echt wichtig. Also, mit Leidenschaft, bitteschön!
Die Deutschen und die Liebe
Viele schöne Dinge kommen aus dem Ausland oder werden dort viel mehr geschätzt. Lebensart, Mode, Kunst, Essen. Irgendwo habe ich gelesen, dass die Deutschen es lieben zu wissen, aber sie wissen es nicht zu lieben. Wir wussten es (vielleicht) irgendwann einmal. In der Romantik? Wir scheinen jedenfalls keinen Sinn für die Großartigkeit unserer Existenz zu haben. Oder wir nehmen diesen Wahnsinnsritt gar nicht wahr. Ein Beispiel: das Tragische, das in der Garderobe deutscher Politiker und Celebrities seinen deprimierenden Ausdruck findet. Sie sehen entweder aus, als trügen sie die Dienstanzüge der lokalen Verkehrsbetriebe. Oder, sollte es ein höherpreisiger Anzug sein, dann bitte den unauffälligsten des italienischen oder französischen Designers. Brioni und Hermes haben in ihren Berliner Boutiquen ein extra Shelf für deutsche Politiker, das, nachdem der Politiker den Laden verlassen hat, mit einem Knopfdruck in der Wand verschwindet. Oder man wird gleich ob der Grellheit der Outfits blind. Trägt man Außergewöhnliches oder erfährt der Deutsche medial vermittelt, dass Designer im Spiel sind, wird man medial zerrissen. Entwickelt man gar einen eigenen Still, ist man bestenfalls dekadent oder gleich verdächtig. Kleidet man sich mit Geschmack, wirkt man unseriös, oberflächlich, abgehoben. Ein anderer, nicht weniger dramatischer, Fall: die Farbpalette deutscher Küche, die alles Leid unserer Existenz in sich birgt: beige, grau, braun, manchmal grün (Kohl). Ich muss Euch sagen: Wir leben erst dann wahrhaftig, wenn wir uns interessant kleiden, fühlen, Verzauberndes lesen. Wenn wir von innen nach außen leuchten! Wenn wir mit all dem Reichtum, der Leichtigkeit und der Verspieltheit der Sprache miteinander verkehren. Wenn wir am laufenden Band Geschichten erzählen, Fiktion und Wirklichkeit miteinander vermengen. Und ich spreche nicht von alternativen Fakten, sondern von einer gewissen Leichtigkeit des Seins. Ich liebe den Smalltalk. Er drückt Respekt gegenüber dem Mitmenschen, eine tiefe Liebe zum Leben und zur Sprache aus. Ich habe nichts von Eurer ungefilterten Meinung! Bitte installiert den Filter! Denn eben dieser Filter ist das, was wir Zivilisation nennen. Alle kapieren das. Nur nicht die Deutschen. Smalltalk ist genau das Gegenteil von Oberfläche. In zehn Jahren wird sich keiner an den Inhalt eines Gesprächs erinnern. Aber möglicherweise an eine freundliche Begegnung. Und kommt mir nicht mit Sätzen wie “Wer hat denn Zeit für sowas?” Dem Sensenmann könnt ihr dann erklären, dass nicht genügend Zeit war schön zu sprechen und zu leben. Übersetzen wir den glühenden Kern unserer Existenz, der letztlich Liebe ist, in schöne Formen, werden wir zu Menschen.
Türstopperkunst
Von einer solchen Lebenskunst sieht man in der aktuell erscheinenden Literatur genauso wenig wie im Alltag. Unterhaltung ist in Deutschland mittelmäßig, und das scheint gewollt. Entertainment wird als oberflächlich-amerikanisch abgetan. Es gibt ein gefährliches Missverständnis zum Verhältnis von Oberfläche und Tiefe, das tief in das deutsche Selbstverständnis hineinragt. Thomas Mann erregt sich in seiner Rede in der Library of Congress “Deutschland und die Deutschen” über die verheerende deutsche Arroganz, das Leben tiefer verstehen zu wollen als der Rest der Welt. Dass die Kunst unsere Existenz in göttliche Sphären hebt, bleibt hierzulande ein feuchter Traum des Ästheten. Das ist aber ihre Aufgabe. Kunst ist eigentlich nichts anderes als das Anhalten des Lebens für einen kurzen, unwirklichen Moment, sodass die Absurdität unserer Existenz darin in den buntesten Farben aufleuchtet. Kunst zeigt auf die schönste Art und Weise die Unmöglichkeit des Denkens, zum letzten Grund vorzudringen. In ihr offenbart sich, dass das Denken selbst die Idee des Absoluten erst hervorbringt. Deswegen ist jede gute Philosophie letzten Endes sowieso Kunst. Am Ende des Gedankens muss die Liebe stehen. Das ist das ethische Gesetz, das sich aus der gescheiterten Mission der Logik ableitet, zum Sinn vorzudringen. Vielleicht eine Liebe und eine Leidenschaft, die aus dem Gefühl dieses Unvermögens heraus geboren wurden? Bezogen auf die Literatur ist die spezifische Architektur der jeweiligen fiktionalen Welt die Form, die diese Liebe annimmt. Nun ist so viel, was unter dem Begriff “Kunst” geführt wird, leider leer. Inwiefern leer? Es hat keine Seele. In die Fantasiewelt der meisten Romane oder Serien schaffe ich es nicht hinein. Die meisten Bücher will ich in die Ecke pfeffern oder als Türstopper verwenden. Mit schlechten Serien ist nicht einmal das möglich.
Das Feuer der Kunst
Neulich durfte ich endlich wieder Kunst erleben. Ich werde versuchen, in der seelenlosen Sprache der Analyse auszudrücken, warum ich als unsichtbarer Mitschüler jeden Tag mit der Teenagerin Bethan in eine Highschool in Wales gegangen bin, warum ich mich zwei Staffeln lang in der Welt der Serie In My Skin verloren habe. Der reale Kern der Entzündung ist gar nicht so einfach zu benennen. Ich erinnere mich an die britische Serie Skins, die mich sogar noch stärker berührt hat. Und natürlich ist mir bewusst, dass es subjektiv ist, was den Einzelnen bewegt. Trotzdem gibt es dieses glühende Zentrum, das emotionale Feuer guter Kunst. Ich glaube, es hat mit dem Ins-Leben-Geworfensein, also dem empfundenen Chaos und schließlich mit den daraus resultierenden Formen, Lebensformen, zu tun. Eigentlich ist das, was im Leben junger Menschen jenseits des Klassenzimmers stattfindet - abends auf einer Party, am Lagerfeuer, im Wald, im Cafe - Gespräche, Mode, Getränke, Illusionen und Visionen, Liebeleien, all das ist ja schon Kunst. Es ist das Abenteuer, das wir als junge Menschen daraus machen, wenn noch alles offen ist. Die eigene Sprache, die wir entwickeln, um uns unsere eigene Wirklichkeit anzuverwandlen. Intensives Leben, Feuer, Widerstand gegen die Angepasstheit der Elterngeneration, Kampf gegen die nichtenden Kräfte des Todes, Nichtanerkennenwollen der stumpfen Wirklichkeit, wie sie sich im individuellen Umfeld der Familie und anderer Autoritätspersonen ausgeformt hat.
In einer schwierigen Nacht fand ich in der ARTE-Mediathek die Serie, die in Wales spielt. Schon in der ersten Folge versank ich voll in der Welt Bethan Gwyndafs, die ihren Freunden ziemlich kreative Lügengeschichten über ihr Leben erzählt. Wie wunderschön-lautmalerisch ist schon der walisische Nachname, bitte? Bethan Gwyndaf lügt aus Scham, um eine kaum zu ertragende Wirklichkeit zu verschleiern. Das wäre die naheliegendste Erklärung. Für mich lebt sie aber in ihren Lügengeschichten erst wirklich. Nein, es geht hier nicht darum, Leiden zu verkennen oder zu stilisieren. Aber in der Leidensgeschichte liegt die Quelle für die kreative Kraft des Mädchens, die später möglicherweise Schriftstellerin wird. Das Erfinden von Geschichten ist jedenfalls Bethans großes Talent, und das ist natürlich als Aussage der Serie über das Geschichtenerzählen im Allgemeinen zu verstehen. Wirklichkeit und Möglichkeit berühren sich hier seinstechnisch fast. Denn worin scheint Bethans Persönlichkeit farbenfroher auf als in ihren Geschichten? Sie umwölken als Möglichkeiten die triste Wirklichkeit ihrer vordergründigen Geschichte. Es ist Zufall, dass Bethan in diese dysfunktionale Familie hineingeboren wurde. Ihr Vater könnte Lehrer, ihre Mutter Hausfrau sein. Sie würde ein möglicherweise unaufgeregtes Leben führen. Als sie gefragt wird, ob sie nachmittags ausgehen möchte, behauptet die Teenagerin, sie habe keine Zeit, weil ihre Familie aktuell einen Wintergarten bekäme. Der wahre Grund für ihre Absenz ist die Mutter, die aufgrund ihrer bipolaren Störung einmal mehr in eine geschlossene Anstalt eingeliefert wird. Wie eng beisammen liegen die Möglichkeit eines Wintergartens und die Einlieferung der Mutter im seinstechnischen Sinne? Wie weit auseinander? Auf figurenpsychologischer Ebene lässt die Lüge das Mädchen den realen Horror nicht nur überleben. Die Lüge wird zur Möglichkeit einer Zukunft. Die Familie ist bettelarm, Bethans Mutter leidet so stark an ihrer psychischen Krankheit, dass der Alltag zum Alptraum wird. Sie läuft weg, halluziniert, und ihre Tochter muss sie immer wieder suchen und nach Hause bringen. Ihr Vater ist ein gewalttätiger Alkoholiker, der Bethan am Ende der Serie einen Laptop fürs Studium schenkt. Ich könnte In My Skin jetzt dafür toll finden, dass die Serie den Alltag von Personen mit psychischen Erkrankungen und deren Familien ins Zentrum rückt. Oder dafür, dass um Verständnis für die Kinder, die in solchen Verhältnissen leben müssen, geworben wird. Ich könnte auch über Bethans holprigen Weg zur Homosexualität schreiben und In My Skin als eine sexuelle Befreiungsgeschichte lesen. Das überlasse ich anderen.
Preaching to the Choir
Es ist mir völlig egal, ob Bethan ein Mädchen oder einen Jungen toll findet. Für mich ist sie eine Teenagerin, die sich nunmal verliebt. Und hört mir auf mit der Scheisse, dass es für viele andere eben nicht normal und deswegen wichtig sei, Homosexualität mehr zu repräsentieren, um ein breiteres gesellschaftliches Verständnis und eine Normalisierung zu bewirken. Komplette Verblendung! Glaubt Ihr wirklich, die breite Masse schaut sich das an? In der ARTE-Mediathek? Seid Ihr wirklich so naiv oder könnt Ihr die Realität nicht ertragen, dass nur wir - ja genau du, der gerade liest, und ich, der gerade schreibt - solche Serien im Bildungsfernsehen schauen? ARTE ist ein Elitenphänomen. Und so wird das auch immer sein. Wir erzeugen diese Produkte für uns selbst. Sie werden nichts verändern. Gar nichts. Nirgendwo. Sie unterhalten uns gut. Und sie lassen uns vor uns selbst gut aussehen. Wenn wir das leugnen, verarschen wir uns nicht nur selbst, sondern weigern uns aktiv, die Dinge klar zu sehen. Vielleicht täusche ich mich, und all das hat langfristig positive Effekte. Und doch gehört es dazu, die Augen zu öffnen, nicht denkfaul zu bleiben, sondern uns ernsthaft zu überlegen, welche Strategien aussichtsreich sind, um die Leute zu erreichen, die es anderen schwer machen.
Kultur? Identität? Selbstfindung? Politik? Fuck off!
Identitätspolitische Lesarten sind leider blind gegenüber der Magie der Serie. Die Vorstellungen darüber, was Kunst sein soll, was sie kann und was nicht, sind total verkommen. Kunst ist, wenn sie echte Kunst ist, sicher nicht unter den Begriff “Kultur” zu bringen. Kunst lässt sich nicht organisieren, verwalten, orchestrieren. Ich muss kotzen, wenn ich derartig tölpelhafte Versuche sehe. “Kulturwirt”, wie fundamental wird Kunst in diesem Berufsterminus missverstanden? Wie verzweifelt der Versuch, sie zu zähmen. Wahrscheinlich, weil man es nicht aushält, dass sie den eigenen Horizont übersteigt. Dass sie letztendlich, by nature, unentschieden, formlos bleiben muss. Zum Glück ist wahre Kunst widerständig. Zum Glück unterspült, überflügelt, erstickt sie diesen Bullshit. Es geht sicher auch nicht um Politik, Identität, um Selbstfindung! Wenn überhaupt, dann ist Kunst Selbstbetrug, Selbstleugnung, ja sogar Selbstabschaffung. Kunst ist immer und sowieso politisch! Allein dass es jemanden gibt, der in der aktuellen Lage schreibt, malt, Filme und Musik macht, ist doch bereits Politik! Alles andere sind spezifische Botschaften, Agendas, Ideologie. Kunst darf niemals mit Ideologie verwechselt werden! Das ist Missbrauch!
Hört auf das Kunstkind!
Hört in dieser Sache auf das Malerkind Jonathan Meese. Und hört auf, Eure meinetwegen gut gemeinten Ideen, der Kunst unterjubeln zu wollen oder sie als Lastenesel zu missbrauchen! Versteht mich nicht falsch. Ich schätze politische und gesellschaftliche Visionen. Aber nicht auf Kosten der Kunst. Sonst wird es banal. Kunst bedeutet absolute Selbstaufopferung für das Höhere. Jeden Tag bis ans Limit gehen. Die Geschichte von Bethan Gwyndaf, die herausfindet, dass sie lesbisch ist, ist viel mehr als eine sexuelle Befreiungsgeschichte. Oder gar eine Geschichte über psychische Krankheit, Alkoholismus und Trauma. Schon auch irgendwie, aber eben nicht nur. Und das muss man kapieren. Für den Sog, den die Story ausübt, sind die Geschichten der psychischen Krankheit der Mutter, des gewalttätigen Vaters, der Homosexualität Bethans “nur” die Ausgangslage. Viele andere Strukturen sind denkbar. Sie sind als Problemgeschichten irrelevant, wenn wir die Mechanik der Liebe der Geschichte bestaunen wollen. Wir sollten unseren Blick nicht verschwenden. Die Kunst in der Geschichte Bethans liegt in der Sprache, im walisischen Dialekt. In der spezifischen Seinsform dieser kleinen Welt und ihrer Charaktere.
Vom Wahnsinn, eine Geschichte zu erzählen
Die Magie entsteht für den Zuschauer, wenn Bethan die Treppe in ihrem kleinen Reihenhaus hoch rennt. Wenn sie mit ihrer Oma am Telefon scherzt, in dem Wissen, dass das Gespräch nichts ändern wird. Wenn sie mit ihren Schulkameraden und ihrem Love Interest auf dem Rasen sitzt und darüber spricht, worüber Teenager halt so sprechen. Der Zauber entsteht im leeren Raum vor und nach dem witty banter der angelsächsischen Schüler. Es geht nicht darum, was gesprochen wird. Daran wird sich 30 Jahre später niemand erinnern. Es geht darum, dass mit Feuer, Leidenschaft und gegenseitiger Zuneigung gesprochen wurde. Worüber ist völlig gleichgültig. Liebe zur Welt und ihren Erscheinungsformen! Das ist der metaphysische Klebstoff, der mich wünschen lässt, die Serie würde niemals enden. Mit “metaphysisch” meine ich das Nichts im Zwischenraum. Eine klangvolle Leere, die zwischen Serie und Zuschauer erwächst. Der krude Slang Bethans, der raue Ton, und doch voller Leidenschaft, sind Ausdrucksformen des nackten Überlebens und der Liebe. Das nachfolgende Schweigen lässt die Macht des alles zersetzenden Nichts erahnen, das die fragile Unterhaltung in jedem Moment bedroht. Ein literarisches “Trotzdem”, das gegen den omnipräsenten Tod ins Feld geführt wird, ist die Kunst des Menschseins. Eine Geschichte in die Leere hinein zu erzählen, die diese im Hintergrund mitrauschen lässt, ist große Kunst. Es ist aber auch Kunst, eine fiktionale Welt so zu kreieren, dass dieses Nichts in fiktionalen Welten völlig zum Schweigen gebracht wird. Ich denke an Disney, Harry Potter, Herr der Ringe, Game of Thrones. Absolute entertainment! Ein Grund für das anrührende Gefühl beim Schauen der Serie ist die Erinnerung an die eigene Sterblichkeit, Nostalgie, wenn man dieser liebenswürdigen Teenagerin durch ihr überschaubares Leben und doch dramatisches folgt. In dieser Welt wird der dünne Faden der Klotho sichtbar, an dem unsere Leben aufgehängt sind.
Ein Plädoyer für das Wolkige
Warum ist das Nachdenken über die Kunst für mich überlebenswichtig? Nicht nur, weil ich das meiste im Leben als Zumutung empfinde. In der Kunst liegt die Möglichkeit für ein interessantes Leben. Diesen härtesten Weg der Kunst zu beschreiten, bedeutet, bis über die Ränder unserer Existenz hinaus zu gehen. Wenn wir die Grenze zwischen Kunst und Leben bis zur Unkenntlichkeit entstellen, leben wir. Eigentlich ist intensiv gelebtes Leben Kunst, und man bräuchte beide Begriffe gar nicht mehr. Wieso überhaupt die Unterscheidung? Stellt Euch vor, wie langweilig es eigentlich ist, am Wochenende in ein Museum zu gehen, um dort Kunst “zu genießen”. Man verlässt die “echte” Welt, um einen Raum zu betreten, in dem das Andere bewundert werden darf. Kunst findet in einem extra für sie kuratierten Raum statt. Mit dem Verlassen des Gebäudes, lässt man schließlich die Kunstwelt hinter sich. Gefahr gebannt. Man musste sich keinen Schritt aus der eigenen Komfortzone hinaus bewegen. Nichts hat einen bis ins Mark erschüttert oder die eigenen Kategorien der Wirklichkeitswahrnehmung durcheinander gewürfelt. Das ist aber die Aufgabe der Kunst, neben guter Unterhaltung. Ecce Rafael Horzons Manifest der Neuen Wirklichkeit! In der Schönheit liegt die Möglichkeit zur Freiheit. Die Freiheit, die zugleich die Zumutung mit sich bringt, dass das, was ist, in der Kunst wolkig bleiben muss. Obwohl Robert Musil anfangs mit der Idee des Aktivismus noch sympathisierte, arbeitet der deutsche Literaturwissenschaftler Joseph Vogl in seinem Buch Meteor heraus, dass es sich im Roman Der Mann ohne Eigenschaften um eine Literatur handelt, die diffuse Ereignisräume eröffnet und eben genau nicht konkrete Handlungsanweisungen skizziert. Gerade im Verzicht auf fiktive literarische Ersatzhandlungen und Lösungen wird der Platz für ein wirkliches Tun im Realen freigehalten. Damit wird die Frage nach dem Politischen der Literatur von Vogl beantwortet. Ich möchte noch einen Schritt weiter ins Spekulative hineingehen: Aus dem der Literatur eigenen Raum des Wolkig-Fiktiven erwächst für den Leser eine Intensität, eine Art Handlungsenergie, die dieser dann in reale Formen übersetzen kann. Diese abgeleiteten Manifestationen gehen mit der fiktionalen Welt, die diese ausgelöst hat, nur eine entfernte Verwandtschaftsbeziehung ein.
Richtungen vertreten,/Handeln,/Zu- und Abreisen/ist das Zeichen einer Welt,/die nicht klar sieht
Am Ende dieser kleinen Aufregung möchte ich noch eine Sache ansprechen, die mir in der Serie aufgefallen ist: In der Welt Bethans gibt es keine Entwicklung, solange wir Zuschauer anwesend sind. Ja, sie wird zum Studieren weggehen, aber da werden wir nicht mehr dabei sein. Sobald sich ihr Leben entfalten wird, ist es für die Kunst zu spät. Solange wir zusammen in die Highschool gehen, und sich für einen unwirklichen Moment nichts bewegt, sind wir bei Bethan. Das nimmt mir die Angst vor dem zukünftigen Horror: vor dem Tod der Liebsten, der Einsamkeit, den eigenen seelischen Abgründen. Es gibt da nur Bethan, ihre Liebesgeschichte und am Ende die Idee des College. Entwicklungsfremdheit ist die Tiefe des Weisen.